Renate M. Herrling: JudenHausTöcher. 2020 (Tredition), 267 S. 11,50 €
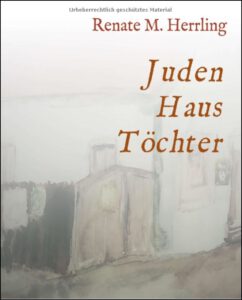 Renate Herrling erzählt in ihrem autobiographischen Roman „JudenHausTöchter“ die Geschichte eines Hauses, das seit Generationen einer jüdischen Familie gehörte. Es steht in einem Dorf in der Pfalz, in einer Straße, die 1933 in Adolf-Hitler- Straße umbenannt wurde. Die jüdische Besitzer dachten nicht an Verkauf, doch als das Haus zwangsversteigert wurde, konnten es die Nachbarn für einen Spottpreis erwerben.
Renate Herrling erzählt in ihrem autobiographischen Roman „JudenHausTöchter“ die Geschichte eines Hauses, das seit Generationen einer jüdischen Familie gehörte. Es steht in einem Dorf in der Pfalz, in einer Straße, die 1933 in Adolf-Hitler- Straße umbenannt wurde. Die jüdische Besitzer dachten nicht an Verkauf, doch als das Haus zwangsversteigert wurde, konnten es die Nachbarn für einen Spottpreis erwerben.
Das Haus wurde schließlich geräumt, und die neuen Besitzer zogen mit ihren beiden Töchtern ins ehemalige Judenhaus um. Wohin die Juden gingen, wusste keiner, weil es keiner wissen wollte. In der Nachkriegszeit eröffnete die inzwischen verwitwete Mutter ein eigenes Geschäft. Zuerst eine Wäscherei mit Vorhangspannerei , dann ein Kolonialwarengeschäft. Das Haus blieb im Besitz der Familie, daran änderte auch der Restitutionsprozeß nichts, der mit einer Wiedergutmachungszahlung an die Söhne der ehemaligen Besitzer, die nach Palästina auswandern konnten, endete.
Renate Herrling erzählt aus der Perspektive ihres Alter Egos, der Enkeltochter Regine. Ihre Erinnerungen machen sich an vielen kleinen Geschichten fest, in denen sie den Zeitraum von 1933 bis heute in den Blick nimmt. Die kurzen Texte, alle mit pointierten Überschriften versehen, die neugierig machen, entwickeln einen Sog, der die Leserin immer mehr in das Geschehen hineinzieht. Herrlings Sprache ist einfach, eindringlich und zuweilen voller lyrische Ausdruckskraft. Die Sätze treffen die Leserin wie ein Blitz des Wiedererkennens, denn Herrling erzählt nicht nur die Geschichte ihrer Familie und ihre eigene – sie entfaltet vielmehr ein Panorama des Alltagslebens in einem pfälzischen Dorf der 1950er und 60er Jahre bis heute. Herrling schildert die Handlungen ihrer Figuren von außen auch in ihrer Sprache, moralfrei ohne anzuklagen. Die im kurpfälzischen Dialekt gefärbten Ausdrücke wie babbel net so dumm, spitzeln und zurechtzuppeln, Mamme und Babbe sind dafür ein Beispiel.
Ich kenne nur eine Schriftstellerin, die einen ähnlichen Stoff ebenso eindrücklich schildert, ja, ihn zum Lebensthema ihres Schreibens gemacht hat. Es ist die französische Autorin Annie Ernaux.
Herrling macht nicht Halt vor unbequemen Wahrheiten. So etwa, wenn die nach Palästina ausgewanderten Söhne nach vielen Jahren zurück in ihr Heimatdorf kommen und die Hausbesitzerin ihnen das Hoftor verschließt. Ist man nicht im Recht? Man hat ja schließlich Wiedergutmachung bezahlen müssen, also hat der Jud hat keine Ansprüche mehr zu stellen.
Am Ende ihres Lebens zieht Regines Mutter Bilanz, erzählt von ihren „drei Wunden“, die sie ein Leben lang mit sich herumtrug. Die Aneignung des „Judenhauses“ nach NaziUnrecht und die verweigerte Geste der Versöhnung zählen nicht dazu.
Nach dem Tod der Mutter findet die Autorin beim Ausräumen des Hauses einen Schnellhefter mit der Aufschrift „Wiedergutmachung“. Mit dem Studium dieser Akte, so Herrling, „bekamen Scham, Selbstzweifel, Verletzungen und unklare Ängste Umrisse, Andeutungen und Ahnungen Namen.“ Es begann ein langer Forschungsprozeß, der zunächst Franziska, der Tochter der jüdischen Familie, galt. Herrling fand heraus, dass sie mit ihrer Mutter nach Gurs deportiert und in Auschwitrz ermordet wurde. Erst danach begann Herrling die Frauen ihrer eigenen Herkunftsfamilie und damit auch ihre eigene Geschichte, in den Blick zu nehmen.
So entstanden die „Geschichten von den JudenHausTöchtern – als Versuch, etwas sichtbar und hörbar zu machen, was unausgesprochen und ungesehen in Familiengeflechten wirkt.“
In dem langen Prozess des Schreibens und Verstehenwollens gelang es der Autorin, diese unheilsame Verkettung aufzubrechen und Raum für wahre Versöhnung zu schaffen.
Heide-Marie Lauterer
Der Begriff „Judenhaus“ ist ein Ausdruck aus dem LTI (Lingua Tertiae Imperii), der nationalsozialistischen Behördensprache. Er bezeichnet ein Wohnhaus aus (ehemaligem) jüdischem Eigentum, in das ausschließlich jüdische Mieter eingewiesen wurden.
Barbara von Hindenburg:
Die Abgeordneten des Preußischen Landtags 1919-1933
Biographie-Herkunft- Geschlecht
 Zivilisationen & Geschichte Bd. 44. Frankfurt am Main 2017. 475 S. ISBN 978-3-631-67651-6, € 89,95.
Zivilisationen & Geschichte Bd. 44. Frankfurt am Main 2017. 475 S. ISBN 978-3-631-67651-6, € 89,95.
Die vorliegende Studie befasst sich mit den Abgeordneten, die zwischen 1919 und 1933 in den Preußischen Landtag gewählt wurden. Sie basiert auf einer Dissertation an der FU Berlin aus dem Jahre 2016. Das Material wurde in drei Phasen von Barbara von Hindenburg erarbeitet. In der ersten Phase wurden die Lebensläufe der Abgeordneten anhand von biographischen Informationen in Parlamentshandbüchern u.ä. erfasst. Mit diesem Material konnte mit finanzieller Unterstützung der DFG ein biographisches Handbuch erstellt werden. Ihre Dissertation baute dann auf der biographischen Analyse des umfangreichen Materials (knapp 1400 Biographien) auf. 2015 wurde von Hindenburg der Nachwuchspreis des Peter Lang Verlags für diese herausragende Leistung verliehen.
Barbara von Hindenburg stand vor erheblichen methodischen Herausforderungen, die sie im ersten Teil ihres Buches ausführlich darstellt. So fehlte es „auf Seiten der Geschlechtergeschichte noch immer an übergreifenden historischen Darstellungen zur Integration von Frauen in Parteien und zur Analyse des ‚männlichen Politikmonopols“ (S. 37). Eine Ursache für die mangelnde Berücksichtigung von geschlechtergeschichtlichen Fragestellungen in der politischen Geschichte liegt in der Begrenzung der hauptsächlich von Männern betriebenen Forschung auf staatliche Institutionen, Parteien, Gewerkschaften etc., in welchen Frauen vor 1919 kaum Handlungsspielräume besaßen. Hier stellt sich die Frage, wer in welchem Zusammenhang eigentlich definierte, was Politik ist. (S. 39) Die Autorin fragt deshalb nach den Grenzen bzw. den Handlungsräumen und somit auch nach den Partizipationsmöglichkeiten von Frauen und Männern in der Politik und den Parteien. Was wurde zeitgenössisch überhaupt als Politik verstanden und wer durfte an Politik partizipieren? (S.40) Suchten sich Frauen andere Handlungsräume als Männer, oder wurden sie ihnen zugewiesen? Um eine Antwort auf diese Fragen zu geben, wertete die Autorin die Lebensläufe der AkteurInnen im „Biographischen Handbuch“ aus. Dabei stieß sie jedoch auch an Grenzen, da die tabellarischen Lebensläufe den Anschein einer Kohärenz oder Kausalität erzeugten. Die Frage nach Zufall oder zielgerichtetem Handeln in den Biographien konnte so nicht erfasst werden. (S. 42)
Weil nach der Einführung des Frauenwahlrechtes 1919 erstmalig auch Parlamentarierinnen in die Verfassungsgebende Preußische Landesversammlung gewählt wurden (6-10% pro Legislaturperiode), untersucht Barbara von Hindenburg die Herkunft der Abgeordneten in geschlechtervergleichender Perspektive und arbeitet sowohl Unterschiede zwischen den Fraktionen als auch Gemeinsamkeiten heraus. So verlief die politische Sozialisation und die Bildungssozialisation von Frauen in Preußen anders als bei Männern. (S. 107) Anders als bei Männern waren für die Frauen die Entwicklung der Frauenbewegung, die zunehmenden Rechte auf lokaler Ebene im Bereich des sozialen Engagements, die Herausgabe neuer Zeitschriften im Rahmen der Frauenbewegung, die Bildung von Frauennetzwerken wichtig, sowie die erweiterten Bildungs-und Berufschancen durch die Zulassung zum Abitur und zum Studium (1908). Bedeutsam für die Frauen war 1908 die Zulassung zu politischen Versammlungen und zu politischen Parteien. Hier konnte von Hindenburg an die Ergebnisse früherer Geschlechterforschung anknüpfen.
Die Studie basiert auf dem qualitativen Generationenbegriff Karl Mannheims. Eine Generation umfasst demnach eine auf altersspezifische Erlebnisschichtung basierende Gemeinschaft, die darauf beruht, Ereignisse und Lebensinhalte aus derselben Bewusstseinsschichtung wahrzunehmen und zu deuten. Von diesen kollektiven Wahrnehmungs-und Deutungsmustern wird angenommen, dass sie zu spezifischen, gesellschaftlich relevanten Handlungen führen. Während die Männergeneration eine deutlich homogenere Gruppe im Hinblick auf ihre Altersstruktur als auch auf ihre politischen Überzeugungen darstellte, hatten die Parlamentarierinnen eine weiter auseinanderliegende Altersstruktur und kamen aus unterschiedlichen politischen Parteien und politischen Sozialisationen. Wie ich bereits in meiner 2002 erschienen Studie „Parlamentarierinnen in Deutschland 1918/19 -1949 dargelegt habe, ist eine Zuordnung von Frauen in ein Generationsschema, das an männlichen Lebensläufen gewonnen wurde, nicht sinnvoll. [1] Barbara von Hindenburg kommt zu dem gleichen Ergebnis, wenn sie betont „Ihr gemeinsamer Bezugspunkt war das Geschlecht und die daraus resultierenden Erfahrungen.“ (S. 138)
Neben der Kategorie ‚Generation‘ nutzt Barbara von Hindenburg im zweiten Hauptkapitel die Kategorie (sozialer) ‚Raum‘ für die Analyse der Biographien der Abgeordneten. Sie nimmt an, dass besondere Voraussetzungen oder Beschränkungen in einzelnen Regionen möglicherweise Einfluss auf Grenzen und Handlungsmöglichkeiten der Abgeordneten hatten. In diesem Kapitel wird die geschlechtergeschichtliche und vergleichende Perspektive zwar beibehalten, aber zugunsten der Erforschung der Frauenbiographien verschoben. Im III. Kapitel ‚Raum und Region‘ wird diese Kategorie für die Analyse der Frauenbiographien fruchtbar gemacht. Schlesien eröffnete den Frauen mit dem ländlich-kommunalen Wahlrecht neue Möglichkeiten der Partizipation. Hier konnten sie ein politisches Recht wahrnehmen, das ihnen nur in den Landgemeinden Preußens, nicht aber in der Rheinprovinz zustand, und sie konnten erstmalig auch Frauen über ihre politischen Rechte aufklären. Zum anderen konnten sie für die Erweiterung dieser Rechte eintreten und dafür auch Überzeugungsarbeit bei Männern leisten. Am Beispiel der Abgeordneten Elsa Hielscher und ihrem Engagement in Schlesien gewinnt die bis dahin sehr theoriegeleitete Darstellung an Plastizität. Die 1871 in Schlesien geborene Elsa Hielscher engagierte sich seit dem Ersten Weltkrieg in der schlesischen Frauenbewegung und der schlesischen Stimmrechtsbewegung. Von 1925 bis 1932 saß sie als Abgeordnete für die DNVP im Preußischen Landtag. Hielscher schrieb nicht nur Artikel für die Zeitschrift des Schlesischen Frauenverbandes, sondern verfasste zahlreiche Gedichte, die einen Einblick in die Zwänge, die Wut, die Erfahrungen der Fremdheit und die Sehnsüchte einer politisch aktiven Frau vor der Einführung des Frauenwahlrechtes geben. Es sind berührende Gedichte, die, wie im Gedicht „Automat“, von einer erschreckenden Dissoziation von Körper und Seele der jungen Frau zeugen, mit der sie sich vor einer seelischen Verkümmerung schützt. Aus diesen Gedichten sprechen die Fremdheitserfahrungen, die sich aus der Frauen zugewiesenen Bestimmung und ihrer Rebellion gegen die gesellschaftliche Konvention ergaben. Später entwickelte Elsa Hielscher eine regelrechte Leidenschaft möglichst viel über die Erfahrungen von unterdrückten Frauen herauszufinden. Sie begab sich auf Reisen in das europäische Ausland. In London hörte sie der Rede einer Suffragette zu, die Hielschers Denkhorizont erweiterte. Obwohl sie sich seit 1903 in der schlesischen Frauenbewegung engagiert hatte, nahm sie hier zum ersten Mal wahr, dass Frauen – im geschützten Raum der Speakers Corner –öffentlich gehört wurden. Ab 1908 engagierte sie sich in der Frauenstimmrechtsbewegung in Schlesien. Elsa Hielscher bereiste die ganze Region, um Frauen und Männer über das aktive Gemeindewahlrecht für unverheiratete oder verwitwete Grundbesitzerinnen aufzuklären. Dieses Recht war vielen Frauen unbekannt oder sie konnten es nicht ausüben, weil sie dafür einen Wahlmann finden mussten. Am Beispiel von Elsa Hielscher kann Barbara von Hindenburg frauengeschichtliche Forschungen ergänzen, die das frühe Engagement der Frauen in den regionalen Frauenvereinen und deren Publikationsorganen sowie in den Kommunen herausgearbeitet haben. [2]
Wann und wie erfolgte die parteipolitische Politisierung der (bürgerlichen) Frauen? Elsa Hielscher arbeitete in der Freikonservativen Partei in Schlesien mit. Die konservativen Parteien lehnten grundsätzlich eine Mitgliedschaft von Frauen ab, doch nahmen einzelne Ortsvereine gelegentlich Frauen auf. Für die Freikonservative Partei gibt es noch keine wissenschaftliche Darstellung, deshalb bezieht sich die Autorin auf die Forschungen von Kirsten Heinsohn zu den konservativen Parteien in Deutschland 1912 bis 1933. [3] In der „Schlesischen Freikonservativen Parteikorrespondenz“ (1913/14) veröffentlichte Elsa Hielscher eine Artikelserie über „Frauen und Politik“. Sie wurden angekündigt als „erste politische Ausführungen einer freikonservativ organisierten Frau“. (S. 277). Ausschlaggebend für Hielschers Wahl der Freikonservativen Partei mag ihre persönliche Bekanntschaft mit Wilhelm von Kardorff gewesen sein, der Frauen in ihrem politischen Engagement unterstützte. Diese Unterstützung von Seiten der Männer erfolgte jedoch nicht aus innerer Überzeugung. Wie Kirstin Heinsohn am Beispiel der Deutschkonservativen Partei zeigt, ging deren Öffnung eine schwere Wahlniederlage voraus. (276) Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Elsa Hielscher wie die meisten konservativen Parteimitglieder Mitglied der neugegründeten DNVP und Vorsitzende des Frauenausschusses Niederschlesiens ihrer Partei.
Bei der Fülle des Materials und der Forschungsliteratur ist es verständlich, dass die eigentliche parlamentarische Tätigkeit der Abgeordneten sowie die Erforschung der Lebensläufe in der Zeit des Nationalsozialismus oder die Fortsetzung der politischen Laufbahn nach 1945 nicht untersucht werden konnten. Hier bleibt die vorliegende Studie jedoch hinter den Ergebnissen der bereits genannten früheren Forschungen zurück. Nur wenn man das politische Handeln der Frauen in den Parteien und Parlamenten miteinbezieht, kann geklärt werden, ob und inwiefern die Kategorie Geschlecht das politische Handeln von Frauen prägte.
Die umfangreiche und kompetent recherchierte Darstellung lässt auf weitere geschlechtergeschichtliche Studien in der Politikgeschichte hoffen. Mit ihrer Analyse hat Barbara von Hindenburg gezeigt, dass eine Erforschung der Frauengeschichte nur mit einer heterogenen und methodisch vielfältigen Herangehensweise zu leisten ist. Karin Hausens Plädoyer für die „Nicht-Einheit der Geschichte“ ermöglicht es, immer mehr von den Meistererzählungen abzurücken. Mit den Gedichtzeilen von Elsa Hielscher ausgedrückt, gilt es:“ Alte Begriffe (zu) überwinden, Mut zu ganz neuer Wertung (zu) finden, jedes Wissenstor furchtlos (zu) erschließen …“ (S. 246).
[1] Heide-Marie Lauterer, Parlamentarierinnen in Deutschland 1918/19-1949. Königstein/Ts 2002, S. 50.
[2] Vgl. Kerstin Wolff, „Stadtmütter“: Bürgerliche Frauen und ihr Einfluss auf die Kommunalpolitik im 19. Jahrhundert (1860-1900), Königstein/Taunus 2003
[3] Kirstin Heinsohn, Konservative Parteien in Deutschland 1912-1933. Demokratisierung und Partizipation in geschlechterhistorischer Perspektive. Düsseldorf 2010.
Claus Melter (Hrsg.)
Krankenmorde im Kinderkrankenhaus „Sonnenschein“ in Bethel in der NS-Zeit?
Forschungen zu Sozialer Arbeit, Medizin und Euthanasie. Beltz Juventa, Weinheim-Basel 2020.
 Der vorliegende Band fasst die Forschungsergebnisse zusammen, die eine Forschungsgruppe der FH Bielefeld zur Geschichte Bethels im Nationalsozialismus erarbeitet hat. In 18 Beiträgen gehen die Sozialwissenschaftler*innen und Zeitzeug*innen der Frage nach den Krankenmorden im Kinderkrankenhaus „Sonnenschein“ nach. Sie beleuchten die Thematik aus verschiedenen Perspektiven: Sozialgeschichtlich, mentalitätsgeschichtlich, medizingeschichtlich und diakoniegeschichtlich. Auch wird der Frage nach dem Widerstand gegen die NS-Ideologie und deren Umsetzung in den sog. „Euthanasie“- morden nachgegangen.
Der vorliegende Band fasst die Forschungsergebnisse zusammen, die eine Forschungsgruppe der FH Bielefeld zur Geschichte Bethels im Nationalsozialismus erarbeitet hat. In 18 Beiträgen gehen die Sozialwissenschaftler*innen und Zeitzeug*innen der Frage nach den Krankenmorden im Kinderkrankenhaus „Sonnenschein“ nach. Sie beleuchten die Thematik aus verschiedenen Perspektiven: Sozialgeschichtlich, mentalitätsgeschichtlich, medizingeschichtlich und diakoniegeschichtlich. Auch wird der Frage nach dem Widerstand gegen die NS-Ideologie und deren Umsetzung in den sog. „Euthanasie“- morden nachgegangen.
Der Anstoß für dieses Buch ging u. a. von Barbara Degen aus, die in ihrer Publikation „ Bethel in der NS-Zeit. Die verschwiegene Geschichte“ (2014) die Frage stellte, warum im Säuglings- und Kinderkrankenhaus „Sonnenschein“ von Bethel in der NS-Zeit über 2000 Kinder gestorben sind und die Sterbequote von 7% im Jahr 1933 auf über 20% in den Jahren 1940-1945 anstieg.
Obwohl bis heute die Erforschung der Frage nach den Säuglingsmorden ein noch weitgehend unbearbeitete Feld der „Euthanasie“-forschung ist, zeigen die Indizien und Argumentationsketten des vorliegenden Bandes, die auf akribisch durchgeführten Archivrecherchen beruhen, dass im Kinderkrankenhaus Sonnenschein in Bethel in der Zeit des NS systematisch Säuglinge getötet wurden.
Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat nach einer Tagung im Januar 2019 und Vorträgen an der FH Bielefeld ein polizeiliches Vorermittlungsverfahren wegen möglichen Totschlages/Mordes an Säuglingen in Bethel eingeleitet. Dieses Verfahren wird fortgeführt und mündet möglicherweise in ein Hauptermittlungsverfahren.
Dass die Erforschung und Klärung dieser Fragen so lange gedauert hat, ist nicht zuletzt auch auf die mangelnde Kooperation Bethels, bzw. die gezielte Vertuschung der Tatbestände zurückzuführen. So nutzte Bethel das von Falschaussagen strotzende Buch von Pergande (1958) für eine Widerstands- Heldenerzählung. Überdies wurden alle Krankenakten aus dem Kinderkrankenhaus vernichtet. Das Betheler Hauptarchiv behindert die kritische Forschung, in dem es hohe Hürden für die Einsichtnahme aufbaut, und nicht ständig alle Unterlagen zur Verfügung stellt. Da es immer noch keine detaillierten Findbücher über den Bestand gibt, stellt C. Melter zu Recht die Forderung, das gesamte Archiv in ein unabhängiges Forschungsinstitut oder in staatliche Hand zu überführen. Nur so wird eine unabhängige Forschung möglich werden.
Die Forschungen, die in diesem Band zusammen getragen sind, stellen eine beeindruckende Leistung dar, die gerade heute in den Zeiten der Coronapandemie eine bedrückende Aktualität erlangt. Denn auch heute wieder wird über Fragen der „Auslese“, dem Wert von Menschenleben oder der Triage (wer soll zuerst behandelt werden) gesprochen. Die Bielefelder Forschungsgruppe gibt die Antwort: Alle Menschen sind gleichwertig und nur die Dringlichkeit der Behandlung ist entscheidend. Zu dieser Maxime konnte sich die Anstalt Bethel der Inneren Mission, obwohl sie sich im Nationalsozialismus der Bekennenden Kirche zurechnete, nicht verstehen.
Heute wird entgegen des Bekenntnisses zu „Offenheit und Transparenz“ auf der offiziellen Homepage, immer noch an der oben erwähnten vertuschenden Heldengeschichtsschreibung festgehalten. Hans Walter Schmuhl erwähnt in seiner abschließenden Beurteilung der Euthanasievorgänge in Bethel die Morde an den Kindern und Säuglingen im Krankenhaus „Sonnenschein“ mit keinem Wort und resümiert: „Insofern haben auch glückliche Umstände eine Rolle gespielt, dass aus Bethel relativ wenig Patienten weggekommen sind.“
Nach der Lektüre des vorliegenden Bandes sind solche Resumés weniger denn je glaubwürdig. Umso wichtiger ist es, dass sich das heutige Bethel, das mit seinen über 19 000 Mitarbeiter*innen das größte Sozialunternehmen Europas und der größte Arbeitgeber Bielefelds ist, seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus unvoreingenommen stellt.
Nicht nur deshalb wünsche ich dem vorliegenden Band eine große Leser*innenschaft.
Heide-Marie Lauterer, Oktober 2020